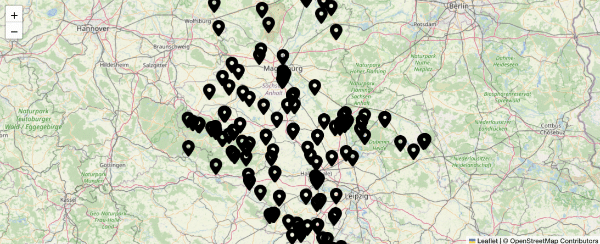Stadtmuseum „Wilhelm von Kügelgen“ Ballenstedt
Ausstellungsschwerpunkt des Museums bilden die wertvollen volkskundlichen Sammlungen zu den Themen „Arbeits- und Lebensweise der Bevölkerung des Anhaltischen Unterharzes“, „Siedlungs- und Kulturgeschichte des Ballenstedter Raumes“ und „Bergbau und Hüttenwesen des anhaltinischen Harzes“ sowie die Erinnerung an berühmte Persönlichkeiten der Stadt Ballenstedt (Wilhelm von Kügelgen; Caroline Bardua).
Ort: Ballenstedt