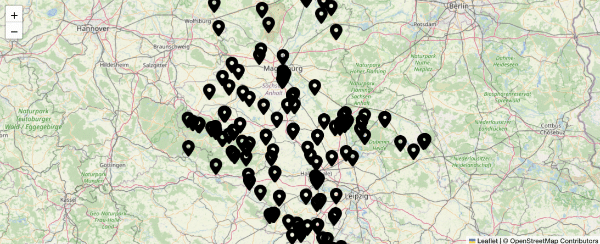Anhaltische Gemäldegalerie Dessau

Die Anhaltische Gemäldegalerie befindet sich im Schloss Georgium mitten im Gartenreich Dessau-Wörlitz und zeichnet sich durch seine wertvolle Gemälde- und Graphiksammlung aus, die Werke vom 15. bis zum 20. Jahrhundert umfasst.
Ort: Dessau